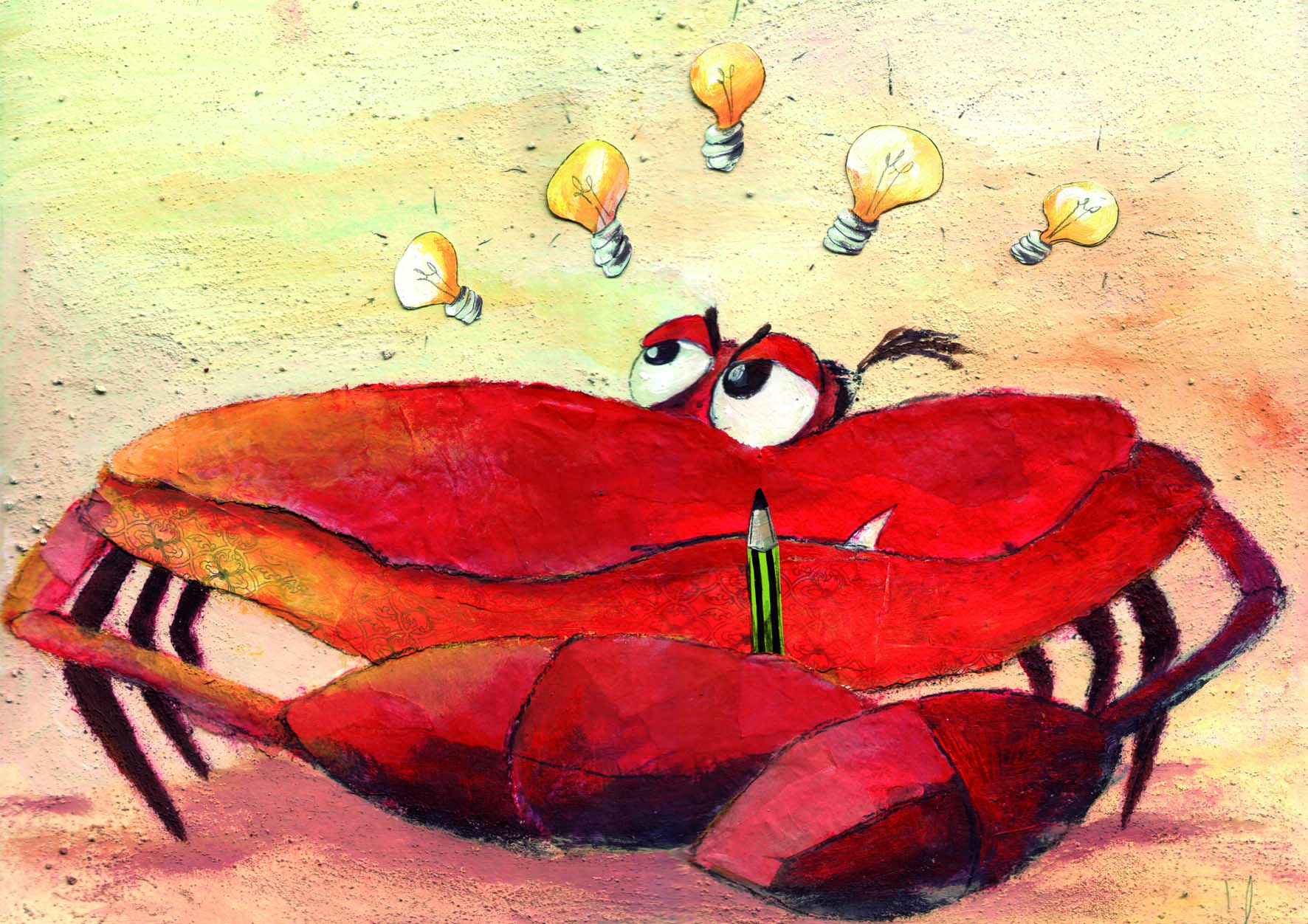Wenn es draußen früh dunkel wird und sich die Natur zum Schlafen hinlegt, schaue ich gerne meinen Gedanken, Gefühlen und Geschichten zu, wie sie (noch) als Versatzstücke langsam wieder Zeit und Raum gewinnen. Wichtig ist das „langsam“, denn der Rest des Jahres ist schnell genug.
Im Herbst bade ich ohne Absicht in traurigen Gefühlen und wehmütigen Gedanken. Ohne Zorn fühle ich mehr als ich daran denke, dass so vieles vergangen ist. Ich höre „Coney Island“ von Taylor Swift feat. The National und murmle ohne Zutun die Zeilen „the sun goes down. over and over. colder and colder. I´ve got to say your name.“ Es tut nicht weh, ich flüstere nur „Schade“. Es ist Herbst, wenn müdes Sonnenlicht warm durch Blätter leuchtet, die langsam braun werden.
Ich bin gerne traurig, solange das Gefühl von der Sehnsucht genährt wird.
Grotesk. Je mehr ich Zeit damit vergeude, in den Sozialen Medien anderen bei ihren öffentlich vorgetragenen Leben zuzusehen und mich darüber zu wundern, dass jeder seine Gedanken und Meinungen in die Welt senden muss, desto wertvoller wird mir das Private, das Intime. Und schon steigt das Verlangen, genau dies öffentlich zu machen.
Nur Musik schafft es, mich träumen und weinen zu lassen, mich als tollkühner Abenteurer über das Meer segeln zu lassen.
Wenn ich heute in der Küche sitze und als Vater daran denke und hoffe, dass meine Kinder einmal so warme Gedanken an diese Küche haben wie ich an die meiner Kindheit mit meiner Mutter, meinem Vater und meiner Schwester, wo wir gekocht und gelacht, zusammengesessen und geredet, gestritten und uns wieder verziehen haben, dann tröstet mich dieser Blick in die Zeit, in der ich nicht mehr bin.
Ich sollte nicht so streng mit mir selbst sein. Es schützt vor schlechtem Gewissen und davor, über andere zu urteilen.
Ich bin nicht stolz darauf, aber ich provoziere hin und wieder mit großer Lust Menschen, die immer Recht und damit das letzte Wort haben müssen. Ihre Zwanghaftigkeit raubt ihnen jeden Funken Souveränität, wenn sie einer hingeworfenen Frotzelei die Moral-Keule und Wahrhaftigkeits-Peitsche entgegenschwingen müssen. Schade nur, dass im Verlauf eines solchen Wordduells meine Würde ebenfalls Schaden nimmt.
Zu den Beobachtungen unserer Zeit gehören Beine, die im Nähmaschinen-Stakkato wippen.
Während meines Wehrdienstes stand ich auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr nächtliche Wache. Es hatte minus 20 Grad Celsius und ich fror so erbärmlich, dass ich sterben wollte. Es ist eine schreckliche Erinnerung mit seltsam positiver Nachwirkung bis heute: Immer, wenn ein Tag aus dem Ruder läuft und der Ärger überhandnimmt, nichts gelingen will und sich die Welt gegen mich verschworen zu haben scheint, denke ich mir „Aber wenigstens habe ich es warm.“ Das hilft. Auch 40 Jahre später noch.
Wir alle streben danach, das Leben zu spüren.
Weil es ruhig macht. Ich sollte häufiger an die Gräber gehen und mich um meine Erinnerungen kümmern. Ich sollte mir häufiger Zeit nehmen um durch die Vergangenheit schlendern. Ich sollte häufiger den Friedhof besuchen und milde die Menschen beobachten, die geschäftig an ihren Gräbern ihren Trost finden. Ich sollte häufiger Grabinschriften lesen, um nicht zu vergessen, wie wichtig und schön ein Augenblick ist.