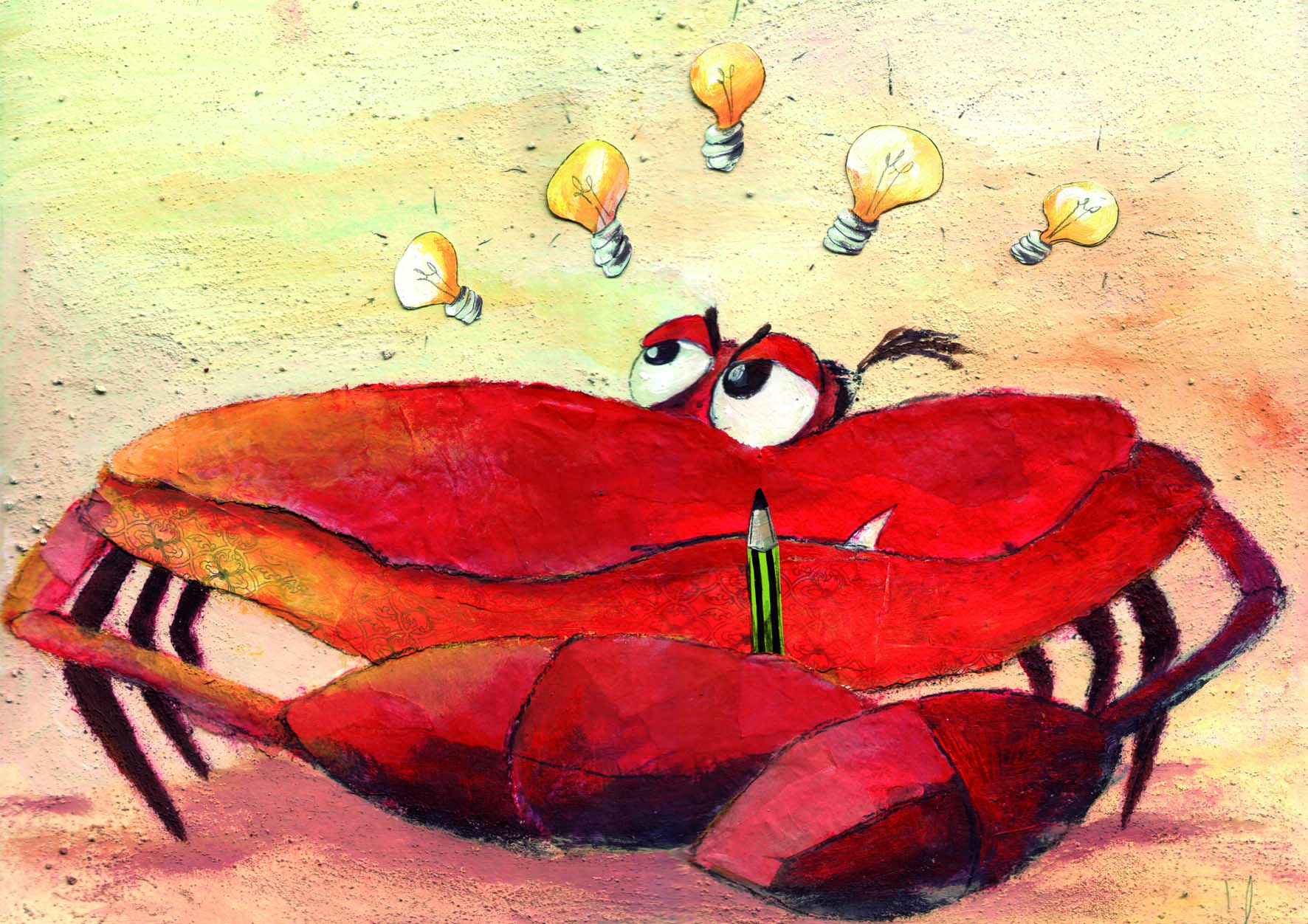Es ist schon ein paar Jahre her, als ein junger Diakon mich bat, im Rahmen einer Andacht und im Vorfeld seiner Priesterweihe und Primiz über meinen persönlichen Glauben zu sprechen. Ich hatte lange überlegt und es dann gerne getan, kürzlich stolperte ich über mein damals abgelegte Glaubenszeugnis. Es gilt für mich auch heute noch.
„Herr, ich bin nicht würdig, dass Du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“
Immer, wenn ich in den Gottesdienst gehe und diesen Satz des heidnischen Hauptmanns von Kafarnaum höre, trifft er mich jedes Mal unvermittelt aufs Neue – und er trifft mich jedes Mal mitten ins Herz.
Das Seltsame daran: Ich habe diese Worte nie so richtig kapiert. Und was für mich noch seltsamer ist: Obwohl mich dieser Satz zutiefst berührt, obwohl ich ihn nie richtig verstanden habe, sah ich auch nie eine besondere Veranlassung, darüber nachzudenken.
Es genügte und genügt mir tatsächlich einfach das Gefühl zu spüren, den diese Worte in mir ganz tief hervorrufen. Es sind schöne Gefühle, die mir immer wieder guttun und mich vor allem zur Ruhe kommen lassen. Wie überhaupt dieses „zur Ruhe kommen“ für mich einer der Hauptgründe ist in eine Kirche zu gehen.
„Herr, ich bin nicht würdig, dass Du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“
Dieser Satz versinnbildlicht im Kleinen ziemlich genau mein generelles Verhältnis zum Glauben.
Ein Bekenntnis zum Glauben ist bei mir alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Denn ich bin nicht von ungefähr Journalist und gelernter Zeitungsredakteur. Als solcher bin ich zuallererst und zuallerletzt zutiefst misstrauisch – und keineswegs gläubig. Ich bin zum Beispiel absolut überzeugt von der Berechtigung unterschiedlicher Meinungen und ich gehe sofort in abwehrende Habachtstellung, wenn ich jemandem begegne, der mir seine Ansicht als Wahrheit verkaufen will.
Ich denke, ich muss nicht eigens betonen, dass dies natürlich ein großes Handicap als Kommunalpolitiker ist und mich in politischen Diskussionen zuweilen in ein schwer aufzulösendes Dilemma bringt.
„Das ist die Wahrheit“ – ich habe sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass dieser Satz ein untrügliches Indiz dafür ist, dass jemand eben nicht die Wahrheit spricht, ob bewusst und mit Vorsatz oder auch nicht, sei dahingestellt.
Und leider ist es auch so, dass ich nur allzu oft habe ich auch an mir persönlich beobachten müssen, dass ich immer dann auf die Richtigkeit einer Aussage poche, wenn ich unsicher bin.
„Herr, ich bin nicht würdig, dass Du eingehst unter mein Dach“.
Ich leiste mir – ganz unbewusst und ohne gedankliche Vorarbeit – den Luxus, in aller Unschuld und Naivität zu glauben. Und wenn es für mich ein persönliches Wunder gibt, dann ist es das, dass ich dies als höchst misstrauischer Mensch, für den der Zweifel ein elementares Lebensprinzip ist, einfach so kann.
Ich will ehrlich sein: Hat Jesus gelebt und ist er Gottes Sohn? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Passt die Mutter Gottes auf meine verstorbenen Großeltern und Eltern auf? Diese und viele weitere sind Fragen, die ich für mich mit einem schlichten und eindeutigen „Ja“ beantworten kann. Mögen andere darüber lachen und spötteln – ich bin sehr froh über dieses Glück und diese, wie ich finde Gnade, an denen ich als vorsichtiger Mensch auch gar nicht rütteln mag.
„Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“
„Warum kannst du einfach glauben? Es gibt doch so unglaublich viele Gründe dagegen. Und sei mal ehrlich: Es gibt keinen Beweis, dass es Gott gibt.“ In Diskussionen mit Freunden höre ich immer diese oder ähnliche Fragen und Sätze. Und sie stimmen ja, denn mit einem Beweis kann ich schlichtweg nicht dienen.
Aber ich bin auch immer wieder erstaunt von der Selbstverständlichkeit, dass ein Nicht-Beweis als Beweis für das Gegenteil verwandt wird.
Es besteht wohl kein Zweifel daran: Offensichtlich ist vom Verstand her Gott nicht zu beweisen. Daran ändert auch nichts die Tatsache, dass es viele große Denker wie zum Beispiel Thomas von Aquin versucht haben. Sie haben mitunter sogar daran geglaubt, sind aber dennoch unterm Strich kläglich daran gescheitert.
Der Verstand, so großartig er uns Menschen auch vorkommen mag, taugt nicht dazu, Gott zu erfahren. Und mögen viele Kirchengelehrte anders argumentieren, für mich war die erste Seligpreisung von Jesu, wie sie im Matthäus-Evangelium zu finden ist, stets auch ein Hinweis für diese These: „Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelsreich.“ Der Verstand, mein Verstand ist in dieser für mich offensichtlichen Argumentation also kein Grund, um zu glauben.
Ich weiß, dass ich jetzt bei manch einem auf völliges Unverständnis stoße, wenn ich sage: Für mich persönlich ist sogar genau das notwendig, um an Gott glauben zu können. Es ist für mich die unbedingte Voraussetzung meines Glaubens, dass hier mein Verstand an seine Grenzen stößt.
Ich glaube an Gott, weil ich ihn nicht begreife – und es ist mir, mit Verlaub, herzlich egal, ob er ein alter Mann mit weißem Rauschebart, ein Auge im Dreieck oder eine diffuse übernatürliche Macht ist – oder ganz weiblich als Mutter Erde aufritt. Christian Morgenstern sagte einmal: „Gott wäre etwas gar Erbärmliches, wenn er sich in einem Menschenkopf begreifen ließe.“
Das ist etwas, das mich überzeugt, denn: Ich bin mir meiner eigenen Fehlerhaftigkeit, meiner Dummheit und meiner großen Unzulänglichkeit in fast allen, wenn nicht sogar in allen Dingen des Lebens bewusst. Ich erfahre dies jeden Tag, zuweilen sehr schmerzhaft – wie also könnte ich glauben, dass sich mit diesem kleinen Kopf Gott begreifen ließe.
„Herr, ich bin nicht würdig, dass Du eingehst unter mein Dach“.
Warum glaube ich? Ich weiß es nicht bzw. ich kann keine Antwort darauf geben, die sich mit sachlichen Argumenten belegen ließe. Ich kann aber davon erzählen, was der Glauben bei mir bewirkt und wie wichtig er für mich als Grundlage meines Lebens ist.
Das Wort – das gesprochene und noch mehr das geschriebene – ist mein Feld, in dem ich agiere. Ich huldige mit aller Leidenschaft dieser menschlichen Fähigkeit der Kommunikation, erfreue mich an großen Meistern von William Shakespeare bis Charles Bukowski und versuche selbst jeden Tag aufs Neue, beruflich und privat Informationen, Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen.
Ich liebe die Sprache, aber noch mehr liebe ich die Musik. Und ich liebe in besonderer Weise viele kirchenmusikalische Werke, allen voran jeden Ton und jede Melodie von Johann Sebastian Bach. Nicht umsonst wird seit alters her die Musik als vornehmster Ausdruck des Heiligen und als göttliche Sprache bezeichnet.
Zurück zum weiten Feld der Worte, wo ich mich etwas heimischer fühle. Und hier begegne ich unweigerlich früher oder später der provozierenden Frage: „Du glaubst? Und was sagst du zu dem Alten Testament?“ Nun, das Alte Testament ist natürlich u. a. eine Sammlung von Geschichten. Sie sind nicht selten barbarisch, manchmal sehr fantastisch – und wenn sie der richtige Erzähler vorträgt, fast immer mitreißend und fesselnd.
Aber sie sind nicht wahr. Sie können gar nicht wahr sein. Denn die Fakten lassen sich nicht belegen – oder sie entspringen unverkennbar der Fantasie oder dem Willen, Menschen zu beeinflussen. Ich persönlich habe für mich entschieden, dass eine solche Sichtweise nicht nur unglaublich langweilig ist und mich der Freude guter Geschichten beraubt, ich halte sie außerdem für viel zu kurz gegriffen.
Eine gute Geschichte definiert sich nicht über blanke Zahlen und beweisbare Fakten, manchmal liegt ihre eigene Wahrheit viel tiefer. Ich mag gute Geschichten, weil sie häufig ehrlicher sind, indem sie eben nicht für sich beanspruchen, automatisch richtig zu sein. Gute Geschichten bringen mich zum Nachdenken – und wenn ich Glück habe, dann lassen sie mich dabei auch noch schmunzeln.
„Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“
Ich glaube aus tiefstem Herzen, dass Gott Humor hat und uns den Humor bzw. die Ironie als eines seiner wertvollsten Geschenke u.a. für die traurigen Momente unseres Lebens mitgegeben hat.
„Herr, ich bin nicht würdig, dass Du eingehst unter mein Dach“.
Wenn ich über meinen Glauben nachdenke, dann bin ich unweigerlich sofort bei der Frage nach dem „Sinn des Lebens“. Oder andersherum: Wenn mich die Frage nach dem „Sinn des Lebens“ umtreibt, hilft mir am Ende nur der Glaube.
Karriere, Urlaub, Reichtum, berufliche Erfüllung, Macht, Glück, Schönheit, Genuss oder in meinem Fall ein gelungener Text – natürlich tauchen solche Begriffe in meinem Alltagsleben immer wieder auf. Und manchmal ist auch der eine oder andere gerade wichtig für mich. Und nicht selten verfalle ich der Versuchung und dem Irrtum, dass ich doch etwas Dauerhaftes, etwas für die Nachwelt schaffen möchte.
Und dann erinnere mich an die wissenschaftlichen Modelle, die besagen, dass bis zum Zusammenbruch der lebensspendenden Sonne nicht nur unsere Spezies längst ausgestorben ist, sondern sich bis dahin nacheinander bis zu fünf neue intelligente Spezies neu entwickelt haben – und dann ebenfalls ausgestorben sein werden. Von dem unendlichen Universum, das in Zeit und Raum unsere kleine Sonne kaum wahrnimmt, ganz zu schweigen.
Ich gebe zu, das klingt jetzt etwas abstrakt. Lassen Sie mich deshalb ein anderes Beispiel anführen: Ich gehe gerne über Friedhöfe und erst kürzlich ging ich in München auf dem Alten Friedhof an zwei Gräbern vorbei, an deren verwitterten Grabsteinen die Namen zweier Toten stand, jeweils 1934 verstorben. Die eine war damals 16 Jahre alt, die andere 84 Jahre.
Über 80 Jahre später kann sich wohl keiner mehr an sie erinnern, über 80 Jahre später ist es aus unserer Sicht nicht mehr relevant, dass sie so unterschiedlich alt geworden sind. Es muss etwas anderes geben als das, was von uns übrigbleibt.
„Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“
Ich habe so viele Fragen und so wenig Antworten. Oder wie mein damaliger Professor vor Beginn des Seminars „Griechische Philosophie“ im 2. Semester meines Studiums zu mir sagte: „Wenn Sie hier Antworten erwarten, dann sind Sie an der falschen Stelle. Denn Antworten bekommen Sie hier nicht. Aber mit etwas Glück, Krebs, lernen Sie, besser zu fragen.“
Wie bereits gesagt, frage ich nicht, warum ich glaube. Ich frage aber, was es für mich ganz praktisch bedeutet, zu glauben. Welche Bedeutung und welche Folgen es für mich hat und wie ich damit umgehe. Muss ich zum Beispiel in die Kirche gehen? Oder wäre es nicht besser, wie angeblich so viele andere in den Wald zu gehen, um zu beten?
Abgesehen davon, dass ich sehr oft im Wald spaziere und noch nie einen getroffen habe, der betet, kann ich doch ganz gut beides tun: In der Kirche und im Wald beten. „Das eine tun und das andere nicht lassen“ ist zugegebenermaßen eine Lebensparole, die ich manchmal über Gebühr strapaziere, die mir ungeachtet dessen aber häufig als die beste Lösung in einem augenscheinlichen Dilemma erscheint.
Kirchgang oder nicht – das ist eine vergleichsweise einfache Entscheidung. Eine viel schwierigere Frage: Wie steht es denn mit der Sünde? Bekomme ich das denn halbwegs hin, nicht zu sündigen – und kann ich ehrlicherweise überhaupt so häufig zur Beichte gehen, wie es vielleicht nötig wäre.
„Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“
Neben dem Satz des Hauptmanns von Kafarnaum gibt es für mich eine zweite Säule, die meinen Gauben trägt. Und sie ist ebenso für mich in ihrer Tiefe unbegreiflich … und dennoch unumstößlich. Es ist das allgemeine Schuldbekenntnis, die Confiteor, und ihre indirekte Ableitung. Dort heißt es „Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken“, was ja in der Konsequenz so viel bedeutet wie: „Du sollst nicht sündigen in Gedanken, Worten und Werken.“
Als rechtschaffener Mensch mag es gelingen, nicht in Werken zu sündigen. Ich halte es auch nicht für gänzlich unmöglich, dass es Menschen gibt, die nicht in Worten sündigen.
Aber nicht in Gedanken zu sündigen: ich schaffe das bestenfalls nur ganz kurze Zeitspannen lang. Zu leicht bin ich genervt, zu schnell wütend und manchmal leider auch missgünstig, neidisch oder feige.
Ich soll nicht sündigen in Gedanken – dieser unmögliche Auftrag ist für mich persönlich die Befreiung schlechthin. Denn es kann angesichts der menschlichen Unvollkommenheit nur ein Wegweiser sein, aber niemals ein unumstößliches Gebot, bei dem ein Verstoß zu einer wie auch immer gearteten Strafe führen wird. Für mich sind ein liebender Gott und ein Gott, der die permanente Sünde voraussetzt, nicht miteinander vereinbar.
Ich soll nicht sündigen in Gedanken – erst die Unmöglichkeit der Erfüllung gibt mir die Freiheit es zu versuchen. Und zu scheitern. Und es wieder zu versuchen. Und zu scheitern. Und dabei immer zu wissen, dass Gott mich liebt und auf mich aufpasst.
Ich soll nicht sündigen in Gedanken – dieser Wunsch befreit mich von meiner Arroganz, es tatsächlich erfüllen zu können. Er lehrt mich Bescheidenheit und Demut, und es gibt mir das sichere Gefühl, mich auf die Gnade Gottes verlassen zu können, egal was passiert.
Mein Glaube gibt mir Trost, wenn ich verzweifelt bin. Er gibt mir Hoffnung, wenn ich nicht weiterweiß. Er gibt mir Vertrauen, wenn ich zweifle. Er gibt mir das Mitgefühl und die Liebe, wenn es kalt wird. Und er gibt mir die Ruhe, wenn ich nicht aufhören kann zu fragen und zu suchen. Vor allem aber gibt er mir die Fröhlichkeit und die Freude, die mich immer wieder weiterleben lassen.
„Herr, ich bin nicht würdig, dass Du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“